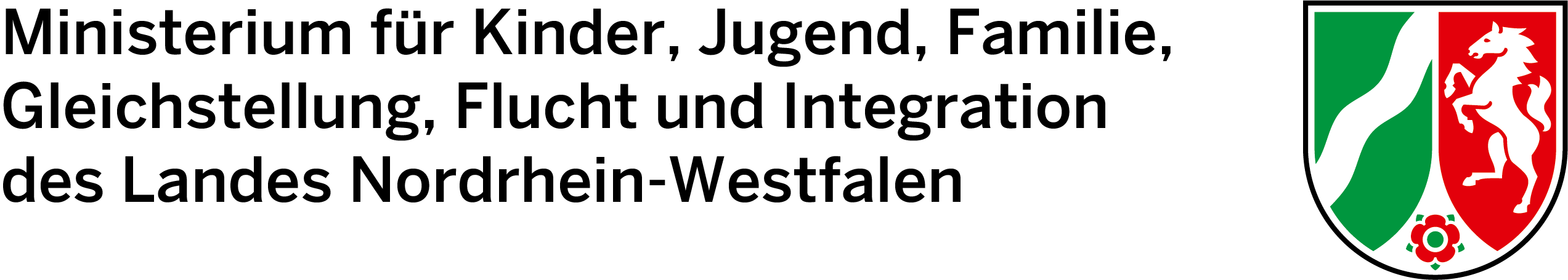Konferenz der für Gleichstellung zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren
Einmal im Jahr kommen die zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder zusammen.
Die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) ist die Fachministerkonferenz, die Grundlinien für eine gemeinsame Gleichstellungs- und Frauenpolitik der Bundesländer festlegt und Maßnahmen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen beschließt.
GFMK 2025: Initiativen aus Nordrhein-Westfalen
In der Rolle des Vorsitzlandes in diesem Jahr setzte Nordrhein-Westfalen mit dem Leitthema „Gleichstellungspolitik für eine starke Demokratie“ ein klares Zeichen: Wenn Frauen sich immer noch und z.T. vermehrt Gewalt, Ausgrenzung und Sexismus ausgesetzt sehen, ist dies eine Bedrohung für die Demokratie. Zentrale Herausforderungen bestehen zudem durch gesellschaftliche Umbrüche wie Digitalisierung, Klimawandel, Migration und soziale Ungleichheit. Diese Entwicklungen erfordern eine erweiterte und differenzierte Gleichstellungspolitik, die alle Geschlechter und insbesondere benachteiligte Gruppen berücksichtigt und stark im Kampf gegen Gewalt an Frauen ist.
Die Essener Erklärung stellt hierzu vier Botschaften auf:
- Gleichstellung verwirklichen – für die Umsetzung unseres Verfassungsauftrags. Trotz Fortschritten bestehen weiterhin Ungleichheiten in Löhnen, Führungspositionen und der Verteilung von Sorgearbeit.
- Vielfältige Gesellschaft – für einen weiten Blick auf Geschlechtergerechtigkeit. Unterschiedliche Lebensrealitäten und Identitäten müssen anerkannt und berücksichtigt werden.
- Zukunftsfähige Demokratie – für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen. Geschlechtergerechtigkeit ist ein Fundament der Demokratie, wird jedoch zunehmend durch Extremismus und Antifeminismus bedroht.
- Konsequente Gewaltfreiheit – analog und digital. Gewalt gegen Frauen untergräbt Gleichheit und Demokratie. Die Istanbul-Konvention und das neue Gewalthilfegesetz werden als wichtige Instrumente begrüßt.
Geschlechtergerechtigkeit ist unverzichtbar für eine stabile Demokratie und ein friedliches, faires Zusammenleben. Sie darf nicht verhandelbar sein. Die GFMK betont, dass Demokratie und Gleichstellung einander bedingen und gemeinsam gestärkt werden müssen.
Wie bereits im letzten Jahr hat Nordrhein-Westfalen auch in 2025 einen Beschluss zur Bekämpfung von Antifeminismus gemeinsam mit den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt eingebracht. Einerseits soll dem Beschluss des Vorjahres Nachdruck verliehen werden, andererseits sollen weitere Handlungserfordernisse aufgezeigt werden. So wird neben einer verstärkten Forschung und gezielteren Erfassung von Antifeminismus auch die Einrichtung einer Social-Media-Kampagne gefordert, um Antifeminismus im digitalen Raum zu begegnen. Außerdem wird zur Stärkung der Demokratiearbeit eine gesetzliche Förderstruktur verlangt und um Antifeminismus auf allen Ebenen begegnen zu können wird ein länder- und ressortübergreifender Austausch gefordert, der auch durch eine auf zwei Jahre angelegte Arbeitsgruppe verfolgt werden soll.
Mit diesem Beschluss der Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt für Frauen“, in welcher Nordrhein -Westfalen mitwirkt, wird die Bundesregierung aufgefordert, im Zuge der Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie ein überarbeitetes Entgelttransparenzgesetz vorzulegen und ein zentrales Datenportal zum Gender Pay Gap einzurichten. Dieses Portal soll bestehende Datenquellen bündeln und auf nationaler, regionaler und branchenspezifischer Ebene für mehr Transparenz sorgen, ohne dabei die bisherigen Instrumente der Länder zu ersetzen. Zudem soll das Merkmal Staatsangehörigkeit künftig in die Auswertung des Gender Pay Gaps einbezogen werden, um intersektionale Ungleichheiten besser zu erfassen. Es wird außerdem darum gebeten, differenzierte Sonderauswertungen wie zum Beispiel den Lohnatlas NRW (Link: https://www.mkjfgfi.nrw/menue/gleichstellung/berufliche-gleichstellung/lohnatlas-nrw) zeitnah öffentlich bereitzustellen.
Nordrhein-Westfalen hat diesen Beschluss gemeinsam mit Baden-Württemberg und Niedersachsen eingebracht, um die wichtige Rolle der Erwerbstätigkeit von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte für gesellschaftliche Teilhabe und Fachkräftesicherung zu betonen und verstärkte Maßnahmen zur Förderung ihrer Arbeitsmarktintegration zu fordern. Insbesondere die Streichung von Sprachkursen sowie fehlende Kinderbetreuungsangebote werden kritisiert, da dies die Teilhabe erschweren. Zudem wird die gesetzliche Verankerung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung sowie Ausbau von Coaching- und Mentoringprogrammen gefordert, um die nachhaltige Beschäftigung zu unterstützen. Auch wird die Notwendigkeit ausreichender Finanzmittel für Jobcenter und niedrigschwellige Angebote hervorgehoben, damit die spezifischen Bedürfnisse zugewanderter Frauen besser berücksichtigt werden können
Die Istanbul-Konvention sieht vor, dass der Staat mit umfassenden Präventionsmaßnahmen dafür sorgen muss, dass Gewalt gar nicht erst ausgeübt wird. Die GFMK begrüßt, dass das kürzlich verabschiedete Gewalthilfegesetz dementsprechend Maßnahmen wie eine frühe und zielgerichtete Prävention einschließlich Maßnahmen, die sich an gewaltausübende Personen richten, als Eckpfeiler des Gewaltschutzes in den Blick nimmt. Nordrhein-Westfalen setzt sich gemeinsam mit Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein dafür ein, Täterarbeit als festen Bestandteil des Gewaltschutzes zu verankern. Ziel ist, durch die Anordnung von Gewaltpräventionskursen im Fall von Betretungs- und Annäherungsverboten und den Einsatz der elektronischen Aufenthaltsüberwachung wirksamer gegen Gewalt vorzugehen.
Digitale Gewalt stellt eine zunehmend wachsende Herausforderung dar und führt zu einer deutlichen Verstärkung von Gewaltverhältnissen und -dynamiken im analogen Raum. Verstärkt wird dies durch die Anonymität und die Orts- sowie Zeitunabhängigkeit des Internets. NRW fordert vor diesem Hintergrund die Einrichtung einer zentralen bundesweiten Anlaufstelle zur Unterstützung von Beschäftigten in Schutz- und Beratungseinrichtungen für von Gewalt betroffene Frauen. Das Ziel ist klar: Es braucht ein professionalisiertes Vorgehen gegen Cyber-Gewalt im persönlichen Umfeld.
In diesem Jahr hat NRW, aufbauend auf dem GFMK-Beschluss von 2020 "Die „Loverboy-Methode“: das Dunkelfeld erhellen - sexueller Ausbeutung vorbeugen“, die Forderung an die Bundesregierung wiederholt, die Forschung zur perfiden „Loverboy-Methode“, einer manipulativen Art der Zwangsprostitution, aufzunehmen. NRW fordert zusammen mit Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein eine Dunkelfeldstudie zur Loverboy-Methode unter Miteinbezug der aktuellen Stakeholder und bereits bestehender Studienlagen. Das Ergebnis der Dunkelfeldstudie soll ein detaillierteres Bild über Ausmaß, Prävention und Intervention liefern.
Das vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesinnovationsprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" entwickelte Modellprojekt „Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt - Ein interdisziplinärer Online-Kurs“ hatte ein webbasiertes interdisziplinäres Fortbildungsangebot zum Ergebnis. Kern des Angebots ist ein kostenloser E-Learning-Kurs für alle Fachkräfte, die im Themenbereich „Häusliche Gewalt“ arbeiten. Die Online-Fortbildung vermittelt umfassendes (Handlungs-) Wissen für die spezialisierte Unterstützung und Versorgung von Betroffenen und ihren Kindern nach Gewalterfahrungen. Seit Juli 2022 wird der Kurs mit Mitteln der Bundesländer (Gleichstellungsressorts) weiterfinanziert.
Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen hin, wird GFMK mit dem o.g. Beschluss weitere Fachminister*innenkonferenzen aus den Bereichen Justiz, Innen, Jugend und Familie, Gesundheit sowie Arbeit und Soziales über das E- Learning-Programm „Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt - Ein interdisziplinärer Online-Kurs“ informieren und darum bitten, die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich tätigen Berufsgruppen auf das E-Learning Programm aufmerksam zu machen und eine Nutzung einzuwerben.
Um Fälle häuslicher Gewalt in familiengerichtlichen Verfahren erkennen und angemessen damit umgehen zu können, müssen alle beteiligten Fachkräfte entsprechend qualifiziert sein. Verfahrensbeistände haben die Aufgabe, die Interessen des Kindes in Erfahrung zu bringen und diesen in familiengerichtlichen Verfahren Geltung zu verschaffen. Als sogenannte „Anwält*in des Kindes“ hat ein Verfahrensbeistand somit eine zentrale Rolle, wenn es im Familiengericht um Umgang oder Sorge geht, und ist eine wichtige Erkenntnisquelle für das Familiengericht. Dies gilt in diesem Zusammenhang insbesondere für die Ermittlung des Sachverhalts in Fällen von Partnerschaftsgewalt. Damit die Verfahrensbeistände in Fällen häuslicher Gewalt die Kindesinteressen adäquat vertreten können, müssen sie entsprechend qualifiziert sein, um Anzeichen häuslicher Gewalt und Gewaltdynamiken in Beziehungen erkennen zu können.
Zwar sind für Verfahrensbeistände seit 2022 konkrete Qualitätsanforderungen und fachliche und persönliche Eignungskriterien geregelt. Allerdings sind u.a. Grundkenntnisse zu der Europaratsleitlinie zur kindgerechten Justiz ebenso wenig vorgesehen wie Grundkenntnisse zu geschlechtsbezogener Gewalt im familiären Umfeld. Zudem gibt es bisher keine konkreten Vorgaben zur Qualifikation und keine verbindlichen Standards für die Ausbildungsinhalte oder eine Zertifizierung und Akkreditierung der Ausbildungsanbieter.
Die GFMK bittet deshalb das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz mit diesem Beschluss um Prüfung, ob u.a. die Vorgaben zur fachlichen Eignung von Verfahrensbeiständen ergänzt werden können. Geprüft werden soll auch, ob die Aus- und Fortbildung für Verfahrensbeistände durch Mindestanforderungen und Standards gestärkt und eine Akkreditierung der Ausbildungsanbieter im Sinne einer Qualitätskontrolle verbindlich geregelt werden kann.
Von Gewalt betroffene Frauen können sich an das vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wenden. Auch von Gewalt betroffene Männer brauchen niedrigschwellig und zeitnah Beratung und Unterstützung. Deshalb haben die Bundesländer Nordrein-Westfalen und Bayern am 22. April 2020 das Beratungsangebot des Hilfetelefons „Gewalt an Männern“ geschaffen. Mittlerweile wird das Männerhilfetelefon von den Bundesländern Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz mitgetragen. Die Zahlen zeigen, dass Ratsuchende aus allen Bundesländern die Hilfeleistung in Anspruch nehmen und das Hilfetelefon so stark ausgelastet ist, dass nicht mehr allen Beratungsersuchen Rechnung getragen werden kann.
Gemeinsam mit den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hat Nordrhein-Westfalen daher den Beschluss eingebracht, ein zentrales Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ aufzubauen. Die Bundesregierung wird dementsprechend aufgefordert, ein auf Dauer angelegtes bundesweites Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ unter der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend einzurichten und zu finanzieren. Dieser Beschluss wurde auf der GFMK Hauptkonferenz in Essen einstimmig gefasst
Nordrhein-Westfalen hat einen Antrag eingebracht, mit welchem die GFMK die Bundesregierung auffordert, eine bundesweite Dunkelfeldstudie zur Gewalt gegen LSBTIQ*-Menschen umzusetzen, da es bislang keine verlässlichen Daten zum tatsächlichen Ausmaß queerfeindlicher Gewalt gibt. Ziel ist es, Schutzlücken zu erkennen, gezielte Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln und die Datengrundlage für politische Entscheidungen zu verbessern. Die Studie soll in Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Ländern, Fachverbänden und der LSBTIQ*-Community konzipiert und durchgeführt sowie aus Bundesmitteln finanziert werden. Hintergrund ist ein deutlicher Anstieg gemeldeter Hasskriminalität und die in Studien belegte Tatsache, dass ein Großteil der Übergriffe nicht angezeigt wird – was psychische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen nach sich zieht
Mit diesem Beschluss, eingebracht von Nordrhein-Westfalen, wird die Bundesregierung aufgefordert, die AIDS-Katastrophe der 1980er- und 1990er-Jahre umfassend historisch aufzuarbeiten. Dabei sollen insbesondere die Perspektiven der am stärksten betroffenen Gruppen wie schwule Männer, trans* Frauen und Sexarbeiter*innen berücksichtigt werden. Ziel ist es, die psychischen und sozialen Folgen der Pandemie sowie die gesellschaftliche Stigmatisierung sichtbar zu machen und zu dokumentieren – auch unter Einbeziehung regionaler Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Zudem sollen Gedenk- und Bildungsprojekte zur Erinnerungskultur finanziell gefördert und neue Initiativen entwickelt werden. Die enge Zusammenarbeit mit Betroffenenorganisationen, Wissenschaft und Politik soll sicherstellen, dass aus der Krise Lehren für den Umgang mit künftigen Epidemien gezogen werden – insbesondere im Hinblick auf die Diskriminierung marginalisierter Gruppen
Die gültige Geschäftsordnung der GFMK erfuhr über die Jahre mehrere Änderungen, zuletzt Ende 2020. Uneindeutige Formulierungen warfen jedoch weitere Fragen auf und machten Änderungsbedarfe deutlich.
Die Arbeitsgruppe, die mit dem Ziel eingesetzt wurde, Fragen zur Geschäftsordnung zu erörtern und Änderungsbedarfe zu identifizieren, hat die Geschäftsordnung überarbeitet. Die erarbeitete und im GFMK-Plenum auf der Hauptkonferenz beschlossene Neufassung ist im Wortlaut verständlicher und in sich kohärent. Die wesentlichste Änderung der Geschäftsordnung ist die Anpassung des erforderlichen Stimmenquorums. Die bisher notwendige Stimmenmehrheit von 13 Stimmen wurde auf eine Zweidrittelmehrheit reduziert (Ziff. 4.2 a.F.). Um zeitlich angemessen auf aktuelle Geschehnisse reagieren zu können, wurde ferner die Frist für die Vorbereitung des Umlaufverfahrens von zehn auf sieben Arbeitstage verkürzt (Ziff. 5.3).
GFMK 2025: GESCHÄFTSSTELLE UND VORSITZ
Zum 01.07.2024 wurde daher im MKJFGFI die Geschäftsstelle GFMK 2025 eingerichtet.
Die GFMK dient der Zusammenarbeit und der Koordinierung der Länderinteressen im Bereich der Gleichstellungspolitik. Die Geschäftsstelle koordiniert die dazu notwendigen Verfahren und richtet die Tagungen und Konferenzen aus.
Die GFMK-Vorkonferenz findet 2025 am 3. und 4. April in Düsseldorf statt, die Hauptkonferenz am 26. und 27. Juni in Essen.
Kontakt
Mail: GS_GFMK25[at]mkjfgfi.nrw.de (GS_GFMK25[at]mkjfgfi[dot]nrw[dot]de)
GFMK 2024: INITIATIVEN AUS NORDRHEIN-WESTFALEN
Der diesjährige Leitantrag, an dessen Erstellung Nordrhein-Westfalen mitgewirkt hat, betrifft die Bereiche feministische Daten- und Wissenspolitik und geschlechtergerechte Teilhabe im digitalen Raum. Damit hat die GFMK in diesem Jahr das Augenmerk auf wesentliche Aspekte in der aktuellen Digitalisierungsdebatte gelegt, wie den Gender Data Gap, digitale (sexualisierte) Gewalt, digitale Teilhabe und die Entwicklung und Anwendung Künstlicher Intelligenz. Der Beschluss stellt eine wichtige Positionierung der Bundesländer hin zu einer geschlechtergerechten Ausgestaltung der digitalen Welt dar. Das Ziel: gleichberechtigte digitale Teilhabe und Repräsentanz von Frauen.
Antragstellendes Bundesland:
BW
Antifeminismus zielt strategisch darauf ab, die Rechte von Frauen und deren Teilhabe in Politik und Gesellschaft in Frage zu stellen und zu untergraben. Von verschiedenen extremistischen Gruppierungen wird er bewusst zur Radikalisierung insbesondere junger Menschen eingesetzt, vor allem im Internet. Der Beschluss warnt vor den Gefahren dieser Ideologie und fordert Sensibilisierung von Behörden und Schulen, sowie Vernetzung des Bundes und der Länder und eine digitale Gegenstrategie. Der Beschluss wurde von den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt gemeinsam erarbeitet und ist sowohl an den Bund als auch an andere Fachministerkonferenzen adressiert.
Das Entgelttransparenzgesetz ist bislang nicht ausreichend wirksam. Die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen besteht weiterhin. Die GFMK fordert daher von der Bundesregierung im Zuge der Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie die zeitnahe Novellierung des Entgelttransparenzgesetzes. Gemeinsam mit den Tarifparteien sollen Wege gefunden werden, Tätigkeiten in Tarifverträgen diskriminierungsfrei zu bewerten. Der Beschlussvorschlag wurde gemeinsam mit Hamburg und Rheinland-Pfalz für die GFMK-Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt für Frauen“ eingebracht.
Bei sexualisierten Deepfakes geht es um eine besondere Form digitaler, sexualisierter Gewalt: KI-generierte bildbasierte Gewalt, die auch häufig antifeministisch motiviert ist.
Genauere Hintergründe zu Verbreitung, technischen Fragen, Strafverfolgung etc. sind vielfach noch unbekannt. Oft fehlt es an Wissen und Sensibilität. Aus diesem Grund sind weitere Forschungen, Schulungen, eine Erhöhung der Ressourcenausstattung und eine Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit dringend erforderlich.
Der Beschluss greift die bestehenden nationalen Regelungslücken im Kontext der KI-Verordnung der EU, dem Digital Services Act und der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auf, die u.a. auch vom Deutschen Juristinnenbund aufgezeigt worden sind.
Antragstellendes Bundesland: Berlin für die AG „Digitalisierung“ und AG „Gewaltschutz“
GFMK 2023: Initiativen aus Nordrhein-Westfalen
In den Kommunen werden Entscheidungen mit Auswirkungen auf das unmittelbare Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger getroffen, bei denen die Perspektive von Frauen gleichwertig einbezogen werden muss. Daran fehlt es häufig, auch aufgrund mangelnder Repräsentation von Frauen in den kommunalen Gremien. Um Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu priorisieren, von guten Beispielen zu lernen und dabei zu helfen, sie bundesweit zu verbreiten, regt der Antrag insbesondere einen konstruktiven Erfahrungsaustausch zwischen den Bundesländern zu diesem Thema an. Ebenso werden die Kommunalen Spitzenverbände ermuntert, die bestehenden Bemühungen zur Steigerung des Frauenanteils im politischen (Ehren-)Amt fortzusetzen und zu intensivieren.
Der Beschluss, den die 33. GFMK auf Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen gefasst hat, ist hier abrufbar:
Das Stillen im öffentlichen Raum muss diskriminierungsfrei möglich sein. Daher adressiert der Beschluss auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen das Anliegen an den Bund, das Stillen im öffentlich zugänglichen Raum besser zu unterstützen und gegen ablehnende Maßnahmen zu schützen. Der Bund wird gebeten, die Rahmenbedingungen zum diskriminierungsfreien Stillen in der Öffentlichkeit in die bestehenden Pläne zur Erhöhung der Stilldauer einzubeziehen und dabei zu prüfen, ob und ggf. welcher weitergehende Regelungsbedarf besteht. Außerdem wird eine bundesweite Kampagne für die Steigerung der Akzeptanz stillender Mütter in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit angeregt.
Der entsprechende Beschluss der 33. GFMK ist hier abrufbar:
Mit diesem Antrag richtet Nordrhein-Westfalen den Blick auf das große berufliche Potenzial zugewanderter Frauen und möchte darauf hinwirken, dass zugewanderte Frauen dieses Potenzial besser entwickeln und einsetzen können. Mentoring-Projekte für zugewanderte Frauen, die in verschiedenen Bundesländern bereits erfolgreich umgesetzt werden, sind dafür in besonderer Weise geeignet. Die GFMK fordert deshalb die Bundesagentur für Arbeit und die zugelassenen kommunalen Träger auf, die erweiterten Möglichkeiten der SGB II-Reform zu nutzen und innovative Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration wie Coaching- und Mentoring-Ansätze zu gestalten.
Der entsprechende Beschluss der 33. GFMK ist hier abrufbar:
Dieser Beschluss fordert den Bund auf, Regelungslücken der am 1. März 2020 in Kraft getretenen Neuregelung zur Abrechnung von Leistungen im Rahmen der vertraulichen Spurensicherung gem. § 27 Abs. 1 SGB V i. V. m. § 132k SGB V zu klären bzw. zu schließen: Die Regelung schafft einen niedrigschwelligen Zugang zur Beweissicherung in Fällen von sexualisierter Gewalt und Misshandlungen, um Betroffenen die Beweisführung in etwaigen späteren strafrechtlichen Verfahren zu ermöglichen. Allerdings sind hiernach ausschließlich Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung anspruchsberechtigt und es ergeben sich umsatzsteuerrechtliche Fragestellungen, die noch nicht gelöst sind.
Außerdem wird die Prüfung einer Übernahme der Kosten der gesetzlichen Krankenversicherungen durch die Strafverfolgungsbehörden bzw. den Täter nach Aufnahme eines Strafermittlungsverfahrens angeregt.
Der entsprechende Beschluss der 33. GFMK ist hier abrufbar:
Gewalt bei familiengerichtlichen Entscheidungen zum Umgangsrecht zwingend Berücksichtigung finden. Ein entsprechender Auftrag der Bundesregierung ist bereits im aktuellen Koalitionsvertrag der regierungstragenden Parteien niedergelegt. Der Beschlussvorschlag knüpft daran an und fordert die Bundesregierung auf, den aus Art. 31 IK resultierenden Handlungsbedarf zeitnah und mit hoher Priorität zu prüfen und umzusetzen.
Der Beschluss, den die 33. GFMK auf Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland gefasst hat, ist hier abrufbar:
GFMK 2022: INITIATIVEN AUS NORDRHEIN-WESTFALEN
Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat die 32. GFMK einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Hier finden Sie einen ausführlichen Bericht der Landesregierung zur 32. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder.
GFMK 2021: INITIATIVEN AUS NORDRHEIN-WESTFALEN
Auf Initiative der Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen hat die 31. GFMK daher einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Um ein bundeseinheitliches Verfahren zu ermöglichen, hat die 31. GFMK auf Initiative Nordrhein-Westfalens mehrheitlich folgenden Beschluss gefasst:
Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen hat die 31. GFMK deshalb mehrheitlich folgenden Beschluss gefasst.
GFMK 2020: INITIATIVEN AUS NORDRHEIN-WESTFALEN
Algorithmen bestimmen zunehmend unser Leben, auch in kritischen Bereichen. Sie reproduzieren teilweise Geschlechter- und andere Stereotypen und können somit diskriminieren. Sie sind aber in ihren Wirkungen noch zu wenig erforscht, bestehende Auskunftsrechte greifen zu kurz und überfordern die einzelne Bürgerin / den einzelnen Bürger. Daher müssen u. a. Gütesiegel für vertrauenswürdige (und nicht diskriminierende) algorithmenbasierte Entscheidungssysteme geschaffen werden.
Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat die 30. GFMK dazu einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat die 30. GFMK im Rahmen der zum 1. Juli 2020 übernommen Deutschen Ratspräsidentschaft einstimmig einen Beschluss zur europäischen Gleichstellungsstrategie 2020-2025 gefasst. Darin wird u. a. die Bundesregierung aufgefordert
- ein Schwerpunktthema der Gleichstellungsstrategie - die Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen - im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung zu setzen
- sich im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft für die in der Gleichstellungsstrategie geforderte europaweite Bekämpfung von Online-Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Form von Hassrede und Mobbing einzusetzen und darauf hinzuwirken, dass Online-Plattformen stärker als bislang in die Pflicht genommen werden
- sich für eine Europaweite Förderung der stärkeren Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und in naturwissenschaftlich-technischen wie auch Berufen des digitalen Sektors zu engagieren, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung des Lohnunterschiedes auf europäischer Ebene zu unterstützen
- eine stärkere Beteiligung von Frauen in Führungspositionen herbeizuführen und die so genannte „gläserne Decke“ zu durchbrechen, indem sie den Richtlinienvorschlag zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen unterstützt und sich im Europäischen Rat für die Aufhebung der Blockade dieser Richtlinie einsetzt.
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Die sogenannte Loverboy-Methode ist besonders perfide, weil sie Mädchen und Frauen unter Vorspiegelung eines Liebesverhältnisses in die Prostitution zwingt. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, weil viele Frauen sich aus Liebe „freiwillig“ prostituieren und darauf verzichten, die Täter anzuzeigen. Die strafrechtlich bekannten Fälle liegen deshalb nur im niedrigstelligen Bereich.
Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat die 30. GFMK daher einstimmig den Beschluss gefasst, bestehende Präventionsmaßnahmen von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Loverboy-Methode weiter auszubauen und die Bundesregierung aufgefordert, das Thema „Sexuelle Ausbeutung durch die Loverboy-Methode“ im Rahmen einer Dunkelfeldstudie aufzugreifen.
GFMK 2019: Initiativen aus Nordrhein-Westfalen
Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen hat die GFMK am 6. Juni 2019 den Beschluss „Für eine wegweisende und nachhaltige Europäische Gleichstellungsstrategie nach 2019“ gefasst. Kernbotschaft ist: Die Europäische Union muss wieder als treibende Kraft für die Gleichstellung der Geschlechter tätig und erkennbar sein. Sie braucht dazu wieder eine Gleichstellungsstrategie, getragen von den Europäischen Institutionen, insbesondere auch von der EU-Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten und unterstützt durch das Europäische Parlament. Zudem werden besondere Anliegen an die deutsche Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020 formuliert, wie die Einsetzung eines Rates der Frauen- und Gleichstellungsministerinnen und - minister, das Hinwirken auf mehr Transparenz über die Umsetzung des EU-Gleichbehandlungsrechts und das Tätigwerden der EU-Kommission bei Umsetzungsdefiziten. Die GFMK weist auch darauf hin, dass die Gleichstellung der Geschlechter zum Kern der europäischen Wertegemeinschaft gehört und bei den Verhandlungen mit EU-Beitrittskandidaten mit Nachdruck vertreten werden muss.
Auf Initiative Nordrhein-Westfalens hat die GFMK einen Beschluss gefasst, der sich an Unternehmen und deren Verbände sowie an öffentliche Verwaltungen und Einrichtungen richtet. Diese in der Werbung für ihre Produkte Frauen und Männer nicht sexistisch darstellen. Wünschenswert wäre eine Selbstverpflichtung, weder mit den eigenen Produkten, noch mit dem dazugehörigen Marketing und Design, Geschlechterklischees zu konstruieren und zu reproduzieren. Unternehmen und deren Verbände werden aufgerufen, keine Preisdifferenzierung nach Geschlecht für funktionsgleiche Produkte zu verlangen und sich noch stärker als bisher für Vielfalt und Gleichstellung zu positionieren.
Mit der Reform des Sexualstrafrechts wurden rechtlichen Schutzlücken geschlossen. Nun stellt sich die Frage, ob sich dies auch in der gerichtlichen Praxis widerspiegelt, z. B. bei den Verurteilungszahlen, der Praxis der Beweiserhebung oder der Schulung von Justizbediensteten. Durch die Evaluierung soll weiterhin bestehender Reformbedarf aufgedeckt werden. Ein diesbezüglicher Beschluss wurde auf der GFMK am 06./07.06.2019 auf Antrag von Nordrhein-Westfalen getroffen.
Menschenhandel ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Die sexuelle Ausbeutung ist die am meisten verbreitetste Ausbeutungsform, von der sowohl im internationalen als auch im nationalen Kontext überwiegend Frauen und Mädchen betroffen sind.
Die Landesregierung hält den Zustand permanenter schwerer Menschenrechtsverletzung durch sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen durch kriminelle Organisationen und Einzeltäterinnen und -täter für untragbar.
Vor diesem Hintergrund hat die GFMK in ihrer Hauptkonferenz am 6./7. Juni 2019 in Deidesheim, Rheinland-Pfalz, auf Antrag Nordrhein-Westfalens einen Beschluss gefasst, der den Bund auffordert, die Bekämpfung von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung in den Fokus zu nehmen, alle bestehenden Regelungslücken zu schließen sowie die Rahmenbedingungen entscheidend zu verbessern. Den noch nicht umgesetzten Empfehlungen der EU bzw. des Europarats soll gefolgt werden. Dazu zählen unter anderem die zügige Einrichtung einer nationalen Berichterstatterstelle und einer Koordinierungsstelle „Menschenhandel“ sowie die Erstellung und Umsetzung eines nationalen Aktionsplans oder einer nationalen Strategie. Darüber hinaus sollen die europarechtlichen Vorgaben der Nichtbestrafung von Opfern des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung für Straftaten, die sie aus ihrer Zwangslage heraus begangen haben, umgesetzt werden.
Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ist seit dem 1. Juli 2017 in Kraft. Es verpflichtet in der Prostitution Tätige zur Anmeldung und gesundheitlichen Beratung sowie Betriebe zur Einholung einer Erlaubnis für ein Prostitutionsgewerbe.
Erste Erfahrungen der Länder mit der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) zeigen, dass die tatsächlichen Anmeldezahlen von Prostituierten deutlich hinter den bisherigen Schätzungen zurückbleiben.
Die GFMK hat auf Initiative der Landesregierungen Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein einen Beschluss gefasst, mit dem das zuständige Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgefordert wird, den für 2019 angekündigten Zwischenbericht zum ProstSchG, der auf der Basis der Bundesstatistik erstellt werden soll, um erste inhaltliche Erkenntnisse der Länder zu ergänzen. In den Zwischenbericht sollen unter anderem auch erste Erkenntnisse darüber einfließen, ob durch das Gesetz wirkungsvoll Menschenhandel und Zwangsprostitution begegnet werden kann.
GFMK 2018: Initiativen aus Nordrhein-Westfalen
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und damit auch Nordrhein-Westfalens wird sowohl von politisch als auch von religiös extremistischen Gruppierungen bedroht. Zu nennen sind hier insbesondere rechtsextremistische Gruppierungen im politischen und der gewaltbereite Salafismus im religiösen Umfeld. Letzterer stellt eine besonders radikale Strömung innerhalb des Islamismus dar.
Die Landesregierung sieht mit großer Sorge, dass politisch und religiös extremistische Gruppierungen in Deutschland verstärkt Zulauf von Mädchen und Frauen erhalten. Frauen spielen in extremistischen Szenen eine wichtige Rolle bei der Vernetzung, der Anwerbung weiterer Anhängerinnen und üben beispielsweise über die Ideologisierung ihrer Kinder massiv Einfluss aus.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung der GFMK in ihrer Jahrestagung vom 7./8. Juni 2018 in Bremerhaven einen Antrag vorgelegt, der unter anderem zum Ziel hat, dass in allen Programmen des Bundes und der Länder zur Demokratieförderung, zur Extremismusprävention und zum Ausstieg aus extremistischen Szenen immer auch die spezifische Rolle von Mädchen und Frauen im Blick zu nehmen ist. Darüber hinaus sollen sich das Bundesamt für Verfassungsschutz und die zuständigen Länderministerien sich verstärkt zum Phänomen "Mädchen und junge Frauen im extremistischen Salafismus" austauschen. Hier erscheint vor allem der Austausch über geeignete Handlungsstrategien zur Prävention und Deradikalisierung sowie zu Ausstiegsprogrammen für Frauen aus der extremistisch-salafistischen Szene sinnvoll.
Seit 2001 gibt es in Nordrhein-Westfalen Modelle und Ansätze einer gerichtsverwertbaren Befunddokumentation und Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt.
Die Anonyme Spurensicherung bezieht sich dabei noch auf die Zielgruppe der weiblichen Opfer von Sexualstraftaten. Die Modelle zur "Anonymen Spurensicherung" wurden entwickelt, weil in Fällen von Sexualstraftaten in der Regel keine Befunddokumentation und Spurensicherung stattfinden, wenn die Betroffenen (zunächst) keine Anzeige erstatten.
Sexualstraftaten sind Offizialdelikte, das heißt sie müssen von Amts wegen verfolgt werden, sobald die Strafverfolgungsbehörden davon Kenntnis erhalten. Viele Betroffene sind jedoch nach einer solchen Gewalttat häufig psychisch nicht in der Lage, direkt Anzeige zu erstatten. "ASS-Modelle" stellen einerseits Kliniken anzeigeunabhängige Regelungen für eine gerichtsverwertbare Untersuchung, Spurendokumentation und –lagerung zur Verfügung. Gleichzeitig gewährleisten sie ein Verfahren, dass die Entscheidung über eine Anzeige und alle damit verbundenen Belastungen in der Hand der Opfer belässt.
Die flächendeckende Bereitstellung eines Angebotes der Anonymen Spurensicherung scheitert häufig an finanziellen Barrieren. Ein Kernelement ist hierbei die fehlende Finanzierung ärztlicher Leistungen im Zusammenhang mit der Befunddokumentation und der erforderlichen Laboruntersuchungen.
Auf Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich die 28. GFMK-Konferenz am 7./8. Juni 2018 in Bremerhaven wie folgt verständigt: "Die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder fordert die Bundesregierung auf, eine bundeseinheitliche Lösung für eine Finanzierung von ärztlichen und labortechnischen Leistungen (einschließlich der ärztlichen Dokumentation) im Rahmen der Anonymen/Vertraulichen Spurensicherung zu schaffen."
Kinder sind von häuslicher Gewalt immer mitbetroffen, sei es, dass sie unmittelbar selbst körperliche Gewalt erleiden, sei es, dass sie Augenzeugen werden. Dies bedeutet eine große psychische Belastung, die in der Regel das weitere Leben mitprägt. Ist der Vater der Täter, kann ein Zielkonflikt zwischen dem Schutzbedürfnis der Frau vor dem Täter auf der einen Seite und dem Umgangs- und Sorgerecht für das Kind auf der anderen Seite hinzukommen.
Nach wie vor kritisieren Fachberatungsstellen und Frauenhäuser, dass Vorfälle häuslicher Gewalt bei gerichtlichen Entscheidungen zum Sorge- und Umgangsrecht häufig nicht berücksichtigt werden, sondern isoliert das Recht des Vaters auf Kontakt zum Kind in den Blick genommen wird. Dabei wird außer Acht gelassen, dass Kontakte zum Kind von gewalttätigen Partnern genutzt werden, die getrenntlebende Partnerin weiter zu bedrohen und unter Druck zu setzen. Vor allem in den Übergabesituationen und bei Umgangskontakten kommt es immer wieder zu Gewalt oder Bedrohungen gegen Frauen oder Kinder. Die das Sorge- und Umgangsverfahren betreffenden Normen des Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) stellen das Wohl des betroffenen Kindes in den Vordergrund. Im gerichtlichen Verfahren wird geprüft, welche sorge- und umgangsrechtlichen Maßnahmen mit dem Wohl des Kindes in Einklang stehen. Dies gilt auch für die Einschränkung und den Ausschluss des Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 4 BGB. Der Schutz und das Wohl eines Elternteils sind keine Bestandteile dieser Normen. Dabei haben nach Artikel 31 Istanbul-Konvention die Familiengerichte bei ihrer Entscheidung über das Sorge- und Umgangsrecht häusliche Gewalt zu berücksichtigen sowie sicherzustellen, dass die Rechte und die Sicherheit der unmittelbar betroffenen Kinder sowie der Elternteile nicht gefährdet werden.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte konstatiert, dass die bisher einzige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die das Kindeswohl explizit in einen engen Zusammenhang mit dem Schutz der von Gewalt betroffenen Sorgeberechtigten stellt, sich auf einen extremen Fall häuslicher Gewalt bezieht. Unklar sei, inwieweit die Gerichte diese konventionskonforme Auslegung auch in weniger eindeutigen Vorfällen anwenden, beispielsweise bei geringer körperlicher Gewalt oder bei psychischer Gewalt nach der Trennung. Auf Antrag von Nordrhein-Westfalen wird die Bundesregierung gebeten, vor dem Hintergrund von Art. 31 der Istanbul-Konvention die sich aus der Studie möglicherweise ergebende Schutzlücke für von Gewalt betroffene Mütter in den Blick zu nehmen.